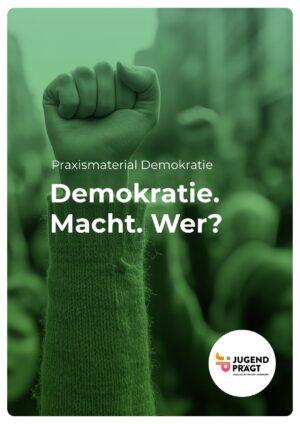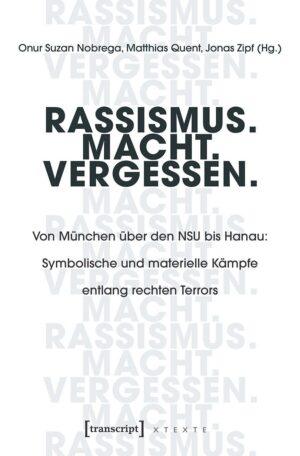BIPoC
Was bedeutet "BIPoC"?
"BIPoC" ist eine politische Selbstbezeichnung und steht für "Black", "Indigenous" und "People of Color" (im Singular "Person of Color"). Die Bezeichnung "People of Color" stammt ursprünglich aus der Kolonialzeit und Sklavenhaltergesellschaft1(Sklavenhaltergesellschaft meint eine Gesellschaftsform, in der Menschen als Sklaven gehalten und als Eigentum betrachtet worden sind. Sklavenhaltergesellschaften gab es schon in der griechischen Antike oder zum Beispiel im Römischen Reich. In Kontext dieses Artikels jedoch, ist die Epoche der Sklaverei gemeint, die während der Kolonialzeit begann. Die Hochphase des kolonialistischen Sklavenhandels kann auf das 16-19. Jahrhundert datiert werden. In dieser Zeit etablierte sich der atlantische Sklavenhandel, in dem europäische Mächte afrikanische Menschen nach Nordamerika verschleppten und diese dort wie Handelsgut für die Sklaverei veräußerten.). Sie wurde für Schwarze2(Schwarz soll hier nicht als beschreibendes Adjektiv verstanden werden. Vielmehr handelt es sich um eine politische Selbstbezeichnung. Aus diesem Grunde wird Schwarz auch großgeschrieben.) Menschen verwendet, die damals als formal frei galten. "People of Color" ist nicht zu verwechseln mit dem rassistischen Ausdruck "Colored".3(vgl. Ha 2007: 34) Ausgehend von der Black Power-Bewegung4(Die Black Power-Bewegung war eine Bürger:innenrechtsbewegung innerhalb der USA, die sich hauptsächlich in den 60er und 70er Jahren abspielte. Gefordert wurden u.a. die Aufhebung der damaligen "Rassentrennung" und die Gleichstellung Schwarzer Menschen. Denn trotz der Abschaffung der Sklaverei 1865 wurden Schwarze, als Menschen zweiter Klasse betrachtet und auf allen Ebenen (d.h. strukturell, institutionell und individuell) diskriminiert. Prominente Vertreter: innen und Symbolfiguren der Bewegung waren beispielsweise Rosa Parks, Angela Davis, Malcom X oder Martin Luther King Jr.), wurde die Bezeichnung von verschiedenen prominenten Schwarzen Akteur:innen und Widerstandskämpfer:innen aufgegriffen. Dadurch sollten Menschen adressiert werden, die rassistischer Diskriminierung ausgesetzt waren. In diesem Sinne gilt "People of Color" auch heutzutage als eine politische Selbstbezeichnung von Menschen, die in der weißen5(Mit weiß ist nicht eine Variante der Hautfarben, sondern eine soziale Position gemeint. Deshalb wird weiß hier bewusst kursiv geschrieben. Es handelt sich um eine privilegierte Position in der Gesellschaft, die Menschen deshalb einnehmen, weil sie selbst nicht rassifiziert werden bzw. auf sich selbst bezogen keinem Rassismus ausgesetzt sind.) Dominanzgesellschaft6(Anders als der Begriff "Mehrheitsgesellschaft" soll mit "Dominanzgesellschaft" darauf hingewiesen werden, dass nicht unbedingt die Mehrheitsverhältnisse entscheidend sind. Vielmehr geht es darum, welche Gruppen mit ihrer Macht dazu fähig sind, innerhalb der Gesellschaft zu dominieren, unabhängig davon, ob sie eine Mehrheit bilden oder nicht.) rassistisch diskriminiert werden. Als eine Art "Kampfbegriff" rückt er die gemeinsam geteilten Rassismuserfahrungen trotz aller ethnischen, nationalen, kulturellen und religiösen Unterschiede ins Zentrum und beabsichtigt Solidarität unter den verschiedenen rassifizierten Gruppen zu stiften.7(vgl. ebd.: 31, 37) Im deutschen Kontext tauchte der PoC-Begriff vor allem in den Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung, als rassistische und antisemitische Angriffe anstiegen, auf.8(vgl. Mohseni 2019: 72) Die Angst vor Ressentiments und Übergriffen schuf das Bedürfnis, Bündnisse unter den unterschiedlichen Betroffenengruppen zu schließen.9(vgl. ebd.) Der PoC-Begriff diente zur Adressierung und Einigung der unterschiedlichen Betroffenengruppen, auch weil sie sich mit bisherigen Fremdbezeichnungen wie "Menschen mit Migrationshintergrund" in ihrer Pluralität nicht fassen ließen.10(vgl. ebd.: 74)
Inzwischen wird der Begriff häufig um die spezifischen Identitätsbezeichnungen "Black" sowie "Indigenous" erweitert ("BIPoC"). Die Heraushebung beider Identitäten lässt sich auf den US-amerikanischen Entstehungskontext und seine Unterdrückungshistorie zurückführen. Dort äußerten sich Stimmen aus rassismuskritischen Kreisen zunehmend besorgt darüber, dass der Genozid an der indigenen Bevölkerung und die Versklavung Schwarzer Menschen im PoC-Schirmbegriff untergehen könnten.11(vgl. Ha 2021) Auch die gestiegene Sichtbarkeit für die systemische Gewalt gegen Schwarze Menschen hat dazu bewogen, mittels der besonderen Herausstellung, auf eben diese spezifischen Gewalterfahrungen aufmerksam zu machen.12(vgl. Ha 2021) Mit der Ermordung George Floyds, einem Schwarzen US-Bürger, durch die grausame Gewalt des weißen Polizisten Derek Chauvin und den darauffolgenden antirassistischen Protesten, erlangte die Thematik im Jahr 2020 eine weltweite Öffentlichkeit. Die nun global stattfindende "Black Lives Matter"-Bewegung13(Für nähere Informationen zur "Black Lives Matter"-Bewegung siehe auch https://blacklivesmatter.com/) hat zur weiteren Verbreitung des BIPoC-Begriffs, auch im deutschsprachigen Raum, beigetragen. Auch wenn sich BIPoC durchgesetzt hat, sind Black und Indigenous nicht als Gegensätze zum PoC-Begriff, sondern als spezifische Heraushebung zweier Gruppen zu begreifen.14(vgl. Ha 2021) Diese Heraushebung ist nicht unumstritten: Beispielsweise kritisiert der Wissenschaftler Kien Nghi Ha, dass die explizite Betonung vereinzelter Identitäten die ursprüngliche Schirmfunktion einer gemeinsamen Selbstbezeichnung unterlaufe und unter den Betroffenengruppen hierarchisiere.15(vgl. Ha: 2021) Dagegen wird wiederum argumentiert, dass die Etablierung des BIPoC-Begriffs den Anspruch verfolgt, die jeweiligen Selbstbezeichnungen der Communities zu respektieren und gleichzeitig einen Begriff zu finden, der einen gemeinsamen politischen Widerstand möglich macht.
Das Konzept "PoC" in der deutschen Übertragung
Vielen Menschen ist die Bezeichnung "People/Person of Color" unbekannt. Das liegt auch daran, dass die Bezeichnung "PoC/BIPoC" weitestgehend in akademischen und aktivistischen Kreisen verwendet wird und aus dem US-amerikanischen Raum importiert wurde.16(vgl. Mohseni 2019: 82) Nicht selten stellen sich Menschen, die Formen von Rassismus erfahren, die Frage, inwiefern sie mit dem Begriff gemeint sind und ob sie ihn für sich beanspruchen dürfen. Im deutschen Kontext bringt die Übertragung des People-of-Color-Konzepts einige Schwierigkeiten mit sich, denn wer mit "PoC" gemeint ist, ist nicht eindeutig geklärt.17(vgl. Mohseni 2019: 83) Als eine deutsche Besonderheit lässt sich beispielsweise die Anwerbephase der 1960er- und 1970er Jahre nennen. Damals kamen sowohl türkische als auch italienische oder beispielsweise griechische Menschen als sog. Gastarbeiter:innen nach Deutschland.18(vgl. Mohseni 2019: 84) So unterschiedlich die migrantischen Gruppen auch waren, sie alle sahen sich dem Rassismus der deutschen Mehrheitsgesellschaft ausgesetzt. Viele rassistische Zuschreibungen und Stereotypisierungen halten bis in die Gegenwart an. Gleichzeitig werden südeuropäische Menschen, insb. Menschen, die als Christ:innen gelesen werden, spätestens seit der europäischen Einigung von der weißen Dominanzgesellschaft stärker als dazugehörig empfunden als beispielsweise muslimisch gelesene Nachkommen türkischer Gastarbeiter:innen.19(vgl. Mohseni 2019: 84f.) Das wirft bei vielen Südeuropäer:innen und Nachfahren die Frage auf, inwiefern sie sich als Person of Color bezeichnen dürfen. In diesem Zusammenhang stellt sich noch die Frage, wie es sich mit Menschen und Angehörigen ehemaliger Kolonialmächte verhält: Ist die Selbstbezeichnung "PoC" passend, wenn das Herkunftsland der Person für die Versklavung, Ausbeutung und Ermordung rassifizierter Menschen verantwortlich war? Auch die Frage danach, inwiefern der PoC-Begriff jüdisches Leben inkludiert, wird nicht einheitlich beantwortet. Viele jüdische Menschen empfinden die Einteilung in "weiß vs. BIPoC" als unbefriedigend.20(vgl. Antmann 2020) Eine weitere Schwierigkeit in der Übertragung auf den deutschen Kontext zeigt sich bei Menschen, die antislawischen Rassismus erfahren. Obwohl sie eine Form von Rassismus erfahren, werden sie beim PoC-Begriff oft nicht mitgedacht, was auch daran liegen mag, dass Osteuropäer:innen oft als weiß gelesen werden, ein Phänomen das auch "Passing"21("Passing" meint, wenn Menschen, das System "passieren" und rassistische Hürden umgehen können, weil sie, beispielsweise aufgrund ihrer äußerlichen Erscheinung, als weiß gelesen werden.) genannt wird.
Ein möglicher Umgang mit der Übertragung des PoC-Begriffs auf den deutschen Kontext besteht darin, ihn für alle Menschen offenzuhalten, die sich von der weißen Dominanzgesellschaft als rassistisch diskriminiert betrachten. Im Sinne der Funktion von Selbstbezeichnungen soll damit nicht von außen vorgegeben werden, wessen Erfahrungen die Inanspruchnahme legitimiert, sondern auf die eigenen Einschätzungen der Menschen vertraut werden.22(vgl. Mohseni 2019: 85)
Warum sind Selbstbezeichnungen wichtig?
Rassifizierte Menschen werden durch Fremdbezeichnungen wie "nicht deutscher Herkunft" oder "mit Migrationshintergrund" stetig als "anders" und "nicht dazugehörig" markiert, ein Prozess, der als Othering bezeichnet wird. Darüber hinaus sagen diese Fremdbezeichnungen oft wenig über die tatsächliche Realität gemeinter Personen aus. Denn als "Menschen mit Migrationshintergrund" werden auch diejenigen bezeichnet, die zwar Rassismus erfahren, aber selbst nie migriert sind oder bereits seit vielen Generationen in Deutschland leben. Gleichzeitig werden weiße Menschen, die tatsächlich migriert sind, nicht als Personen "mit Migrationshintergrund" wahrgenommen. Die Migration selbst oder der sog. Migrationshintergrund sagen also nicht zwangsläufig etwas darüber aus, ob und inwiefern ein Mensch Rassismus erfährt.23(vgl. Mohseni 2019: 67)
Einer politischen Selbstbezeichnung wohnt auch immer die Antwort inne, was genau eigentlich bezeichnet und politisch thematisiert werden soll. Insofern trägt sie dazu bei, die Diskursmacht24(Diskursmacht meint die Macht darüber, einen öffentlichen Diskurs prägen, lenken und dominieren zu können. Diskursmacht zeigt sich daran, wer zu Wort kommen darf, wem Gehör und Glauben geschenkt wird oder wessen Ansichten eine öffentliche Wirkung erzielen können.) zugunsten betroffener Menschen zu verschieben. Selbstbezeichnungen sind Ausdruck politischer Selbstbestimmung und damit Teil eines Selbstermächtigungsprozesses (siehe auch Empowerment). Oft geht damit die Bildung einer Community einher, in welcher füreinander Räume und Angebote geschaffen werden, die der strukturellen Benachteiligung entgegenwirken sollen.25(vgl. Mohseni 2019: 74f.) Anders als rassistische Fremdbezeichnungen geht es bei Selbstbezeichnungen nicht darum, eine wertende Trennung einzuführen. Vielmehr zielen sie darauf ab, durch klare Benennungen von sozialen Positionen, Macht, Privilegien und Benachteiligung sprechbar zu machen, ohne selbst diskriminierende Sprache zu reproduzieren.
Zum Weiterlesen
- Benbrahim, Karima; Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA) (Hrsg.) (2019): Rassismus (be)trifft und ALLE – Rassismuskritische Perspektiven in der Bildungsarbeit. Link zur Publikation (letzter Aufruf: 03.11.2025)
- Farrokhzad, Schahrzad; Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA) (Hrsg.) (2019): Empowerment junger Menschen mit (zugeschriebenem) Migrationshintergrund im Spannungsfeld von Othering und Selbstbemächtigung. Link zur Publikation (letzter Aufruf: 03.11.2025)
- Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusabeit e. V. (IDA) (2022): Was ist eigentlich… Struktureller Rassismus. Link zum Video (letzter Aufruf: 03.11.2025)
- Will, Anne-Kathrin; Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA) (Hrsg.) (2019): Was ist eigentlich ein Migrationshintergrund? Was verbirgt sich dahinter? Link zur Publikation (letzter Aufruf: 03.11.2025)
Quellen
Antmann, Debora (2020): Zwischen den Stühlen, in: Missy Magazine, Kolumne vom 18.08.2020. Link zur Publikation (letzter Aufruf: 03.07.2025)
Ha, Kien Nghi (2007): People of Color – Koloniale Ambivalenzen und historische Kämpfe. In: Ha, Kien Nghi; al-Samarai, Nicola Lauré; Mysorekar, Sheila (Hrsg.): re/visionen. Postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland, UNRAST-Verlag, Münster, S. 31-40.
Ha, Kien Nghi (2021): BIPoC – Der Elefant im Raum, in: Migazine, Essay vom 15.07.2021. Link zur Publikation (letzter Aufruf: 03.07.2025)
Mohseni, Maryam (2020): Empowerment-Workshops für Menschen mit Rassismuserfahrungen. Theoretische Überlegungen und biographisch-professionelles Wissen aus der Bildungspraxis. Springer VS, Wiesbaden.