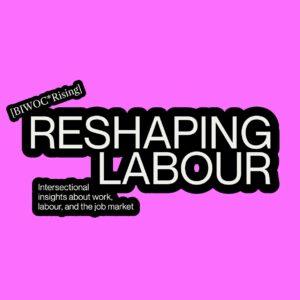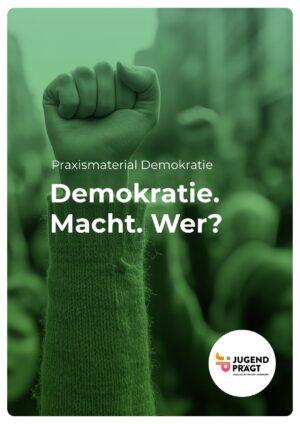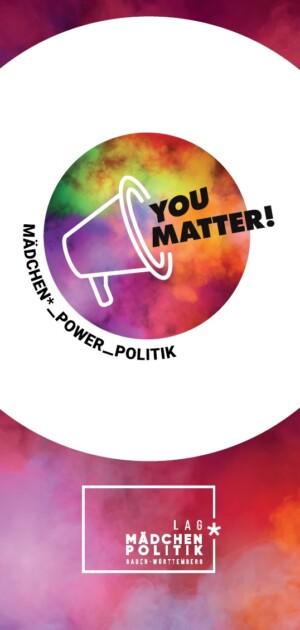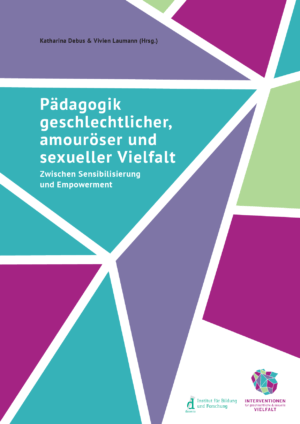Was ist Empowerment?
Was bedeutet Empowerment?
Das englische Wort "Empowerment" heißt übersetzt "Selbstermächtigung". Selbstermächtigung benennt einen Prozess, indem sich diskriminierte Menschen kollektiv gegen strukturelle Unterdrückungen zur Wehr setzen und sich somit Macht erkämpfen. Empowermentprozesse können auf verschiedene gesellschaftliche Veränderungen abzielen und sich deswegen sehr unterschiedlich konkretisieren. Ermächtigung kann beispielsweise
- die Gewinnung von Ressourcen (Erlangung von und Zugang zu Orten/Räumen oder z.B. finanzielle Umverteilung) bedeuten
- das Erlangen von formalen Rechten (z.B. Gleichheits-, Freiheitsrechts- und Partizipationsrechte) bedeuten
- das Erlangen von öffentlicher Aufmerksamkeit (sog. Diskursmacht) bedeuten
- die (Rück-)Gewinnung einer Deutungshoheit1(Deutungshoheit meint die Macht darüber, bestimmen zu können, was als allgemein gültig und formal richtig anerkannt wird) (z.B. über die eigene Geschichte und Identität)
- Selbstbestimmung (z.B. über den Körper, die eigene Selbstbezeichnung und Lebensgestaltung) bedeuten
Das "Selbst" in Selbstermächtigung verweist auf einen wichtigen Aspekt der Definition: Empowerment versteht sich als ein Prozess, der von Betroffenen und ihren Communities als Kollektiv selbst ausgeht und entgegen vieler Missinterpretationen keine von außen fremdgesteuerten oder angeleiteten Vorgänge beschreibt.
Woher kommt Empowerment?
Die Ursprünge des Empowermentbegriffs gehen auf die Schwarze2(Schwarz soll hier nicht als beschreibendes Adjektiv verstanden werden. Vielmehr handelt es sich um eine politische Selbstbezeichnung. Aus diesem Grunde wird Schwarz auch großgeschrieben) Bürger:innenrechtsbewegung und den Kampf gegen rassistische Strukturen in den 1960er und 70er Jahren der USA zurück. Weitere erste Verwendungen des Begriffs finden sich u.a. in feministischen und antikolonialen Befreiungsbewegungen oder z.B. der damaligen Behindertenrechtsbewegung3(Mehr dazu: https://www.socialstudies.com/blog/empowerment-through-advocacy-a-brief-history-of-the-disability-rights-movement). Der Empowermentbegriff, so wie ihn die Schwarze Bürger:innenrechtsbewegung hervorgebracht hat, impliziert Fragen sozialer Ungleichheitsverhältnisse und zielt auf die Veränderung des gesamtgesellschaftlichen Zusammenlebens ab.4(vgl. Chehata et al. 2023: 24) Empowerment ist demnach immer ein politisches Phänomen, bei dem es um die Anprangerung staatlicher sowie gesellschaftlicher Machtverhältnisse geht und dem deshalb die Tendenz zu Konflikten (sog. Konfliktivität) innewohnt.5(vgl. Madjlessi-Roudi/Virchow 2020: 303f.) Beispielsweise zeigen sich Austragungen der Konflikte in Form von zivilem Ungehorsam.6(vgl. Bakic 2014)
Aneignung und Transformation des Begriffs
Inzwischen erscheint der Empowermentbegriff wie ein Modewort, das selbst in kommerziellen Kontexten auftaucht. So vermarkten beispielsweise Kosmetikfirmen Schönheitsprodukte, die das Empowerment von Frauen fördern sollen. Begriffsaneignungen wie diese suggerieren, dass es beim Empowerment um ein subjektives Wohlsein, ein individuelles Gefühl von Stärke ginge.
Der Empowermentbegriff wird aufgrund von Aneignungsprozessen auch in verschiedenen Fachdisziplinen sehr unterschiedlich gedeutet.7(vgl. Chehata et al. 2023: 25) Die ursprüngliche politische Dimension gerät dabei oft in Vergessenheit. In der Sozialen Arbeit lässt sich eine Adaption des Begriffs erkennen, die Empowerment als Handlungskonzept auslegt. Dabei geht es vorwiegend darum, Klient:innen der Sozialen Arbeit zu "empowern". Diesem Verständnis nach dient Empowerment als Methode, Adressat:innen der Sozialen Arbeit durch Anleitung zu etwas befähigen zu können (beispielsweise zu einer selbstständigen Lebensführung). Laut Yasmine Chehata …
"[…] scheint nun Empowerment nichts anderes zu sein als Soziale Arbeit und Soziale Arbeit nichts anderes als Empowerment. Doch dieser Anschein entsteht nur, da es sich hierbei um eine schwache Definition von Empowerment handelt ."8(Chehata et al. 2023: 27f.)
Bei dieser Definition schwingt auch die Gefahr mit, dass Empowerment auf eine individuelle Ebene reduziert wird, d.h., dass nicht die gesellschaftlichen Strukturen, sondern das Individuum selbst "verändert" werden soll.
Empowerment in der Praxis
Die Praxis eines Empowerments basiert auf der Erkenntnis, dass die eigene (Diskriminierungs-)Erfahrung kein Einzelfall, sondern Teil eines größeren strukturellen Ganzen ist. Damit einher geht auch die Erkenntnis, dass Betroffene Teil eines Kollektivs aus anderen Betroffenen sind. Eben dieses Gefühl der Kollektivität dient als Kraftquelle, um Empowermentprozesse anzustoßen. Ein Grundelement für diese Prozesse sind geschützte Räume (sog. Safer Spaces)9(Safer Spaces zeichnen sich dadurch aus, dass sie ausschließlich für betroffene Menschen gedacht sind. Da aber kein Raum gänzlich sicher sein kann und Menschen auch trotz einer geteilten Betroffenheit sehr unterschiedlich privilegiert sein können (siehe auch Intersektionalität), werden diese Räume nicht Safe Spaces, sondern Safer Spaces genannt. Damit wird betont, dass sie zumindest sicherer sind). Darin kommen ausschließlich Menschen zusammen, die ähnliche Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben und von den gleichen Unterdrückungsmechanismen betroffen sind. Dadurch soll ein Austausch ermöglicht werden, bei dem das eigene Erleben und die eigenen Gefühle weniger in Frage gestellt werden und Othering unterbunden wird. In der sozialpädagogischen Arbeit gibt es zahlreiche Empowermentangebote (sog. "Empowerment-Workshops"). Wenngleich der Titel zur fälschlichen Annahme verleitet, Menschen könnten dort empowert werden, geht es vornehmlich darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die eigenen Erfahrungen strukturell bedingt sind und dass Betroffene aus der Kollektivität auch Kraft bzw. Macht schöpfen können. Darüber hinaus können sozialpädagogische Angebote in Form des Powerharings das Empowerment betroffener Menschen unterstützen.
Zum Weiterlesen
- Bollwinkel, Keele; Tsepo Andreas (2023a): Resilience, Resistance, Revolution. Was Empowerment für Schwarze Menschen bedeuten kann. In: Chehata, Yasmine; Jagusch, Birgit (Hrsg.): Empowerment und Powersharing. Ankerpunkte – Positionierungen – Arenen, Beltz Juventa Verlag (2.Aufl.), Weinheim Basel, S. 24-32.
- Bollwinkel, Keele; Tsepo Andreas (2023b): Widerständig! Feiern! Zur (Re-)Politisierung von Empowerment. In: Chehata, Yasmine; Jagusch, Birgit (Hrsg.): Empowerment und Powersharing. Ankerpunkte – Positionierungen – Arenen, Beltz Juventa Verlag (2.Aufl.), Weinheim Basel, S. 314-321.
Quellen
- Bakic, Josef (2014): Empowerment. In: Düring, Diana et al. (Hrsg.): Kritisches Glossar – Hilfen zur Erziehung, IGfH-Eigenverlag, Frankfurt am Main, S. 108–113. Link zur Publikation (letzter Aufruf: 29.08.2025).
- Chehata, Yasmine et al. (2023): Empowerment, Resilienz und Powersharing in der Migrationsgesellschaft. Theorien – Praktiken – Akteur*innen. In: Chehata, Yasmine; Jagusch, Birgit (Hrsg.): Diversität in der Sozialen Arbeit, Beltz Juventa Verlag, Weinheim.
- Hendricks, Monet (2024): Empowerment Through Advocacy: A Brief History of the Disability Rights Movement, Artikel vom 29.09.2025. Link zur Publikation (letzter Aufruf: 29.08.2025).
- Madjlessi-Roudi, Sara; Virchow, Fabian (2020): Empowerment lernen? Empowerment studieren? In: Jagusch, Birgit; Chehata, Yasmine (Hrsg.): Empowerment und Powersharing. Ankerpunkte – Positionierungen – Arenen, Beltz Juventa Verlag, Weinheim, S. 302-310.